| Wirtschaftlichkeit |
| Wenn die Effizienz von Gebäuden durch dickere Dämmung, Superfenster und hocheffiziente Wärmerückgewinnung verbessert wird, so sinkt der Jahresheizwärmebedarf. Die Herstellungskosten steigen aber mit den verbesserten Eigenschaften. Diese steigen sogar umso mehr, je niedriger der bereits erreichte Verbrauch ist. Das ist das "Gesetz des schwindenden Grenznutzens". Es scheint daher kaum eine Chance zu geben, die Heizwärmebedarfswerte mit vertretbarem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand unter etwa 30 kWh/(m²a) zu drücken. Das war die weitverbreitete Ansicht der Bauträger in Europa, und deshalb gab es nur wenige Versuche, Gebäude mit noch besserem Wärmeschutz zu errichten. Derzeit gerät die Einstellung jedoch ins Wanken, weil sich die Kenntnisse über das Passivhaus-Konzept sehr schnell ausbreiten: Kann man auf ein konventionelles Heizsystem verzichten, so lassen sich auch die Kosten hierfür einsparen; dies allein kann einen großen Teil der Mehrkosten für die hocheffiziente Lüftung, die besseren Fenster und die Wärmedämmung finanzieren. Darüber hinaus sind die Betriebskosten eines Passivhauses extrem niedrig (50 bis 100 € Heizkosten im Jahr); bezieht man die kapitalisierten Energiekosten mit ein, so können schon heute Passivhäuser gebaut werden, deren Lebenszykluskosten die eines konventionellen Neubaus nicht übersteigen. Die Abbildung unten stellt diese Zusammenhänge grafisch dar. Der Verlauf der Kurve beruht auf Kostenberechnungen für zahlreiche Beispielgebäude und auf abgerechneten Kosten realer Objekte. |
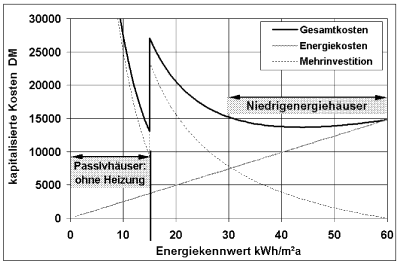 |
| Die Mehrkosten der Komponenten in Passivhaus geeigneter Qualität werden in bald mit Höherer Stückzahl und einer steigenden Zahl von Anbietern weiter fallen. Die über die Lebensdauer eines Hauses gemittelten Energiepreise sind schwer vorherzusagen. Es ist aber anzunehmen, das Energie in Zukunft nicht billiger wird als sie jetzt ist. In einigen Jahren wird somit der Passivhausstandard die Bauart mit den eindeutig niedrigsten Gesamtkosten werden. In der überwiegenden Zahl der Fälle lässt sich schon auf der Basis der heutigen Rahmenbedingungen eine einzelwirtschaftlich vertretbare Amortisation erreichen. |
|
Restheizung
|
weiter
|